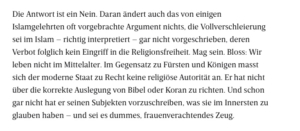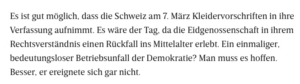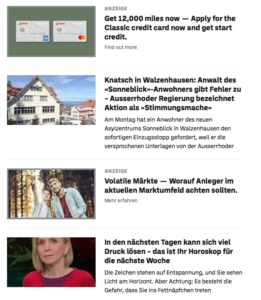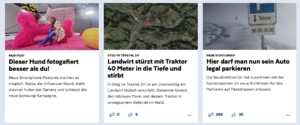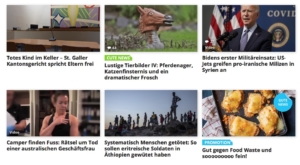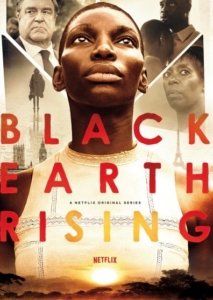«Black Earth Rising» ist nur was für starke Nerven.
Ja, die Miniserie erblickte schon 2018 das Licht der Welt. Sie wurde bereits von BBC2 gezeigt. Sie ist schon einige Zeit auf Netflix.
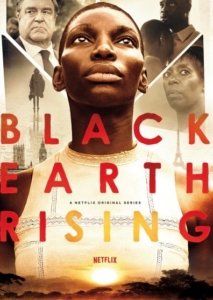
Ich habe sie aber erst vor Kurzem gesehen. Wir leben in abgehärteten Zeiten, und seit Steven Spielberg in «Schindlers List» Juden in die Gaskammern von Auschwitz mit der Kamera begleitete (aber eine akzeptable Auflösung für diesen Tabubruch fand), meinen wir vielleicht, dass schon alles Grauen der Welt in Bilder gefasst wurde.
Wer das Werk von James Nachtwey, Dmitri Baltermanc oder Don McCullin kennt, glaubt vielleicht, dass es zu diesen Schreckenskunstfotos keine Steigerung mehr gibt. Auch das Genre der Antikriegsfilme ist wohlbestückt mit so genialen wie aufrüttelnden Filmen.
Kann man den unvorstellbaren Völkermord in Ruanda verfilmen?
Aber es gibt Ereignisse, die man nicht für adäquat verfilmbar hält. Dazu gehörte für mich der Genozid in Ruanda. In rund 100 Tagen wurden wohl über eine Million Tutsi ermordet. Von einem durch Propaganda, eine Radiostation und finstere Gestalten aufgestachelten Mob. Der Abschuss der Präsidentenmaschine eines diktatorisch regierenden Hutu, der die politische und wirtschaftliche Dominanz der Tutsi gebrochen hatte, die von Uganda aus als Guerilla die Macht zurückerobern wollten, wurde von der Mehrheit der Hutu als Startschuss zu einem in seinem Ausmass unvorstellbaren Massaker genommen.
Mit Macheten, Benzin und Reifen bewaffneter Mob raste, Frauen, Kinder, Alte, Junge, es wurde kein Pardon gegeben. Nachtwey hat wohl das ikonische Bild davon geschossen. Ein Tutsi, dessen Kopf mit langen Narben von den Machetenhieben verunstaltet ist, und in dessen Augen ein unauslöschliches Entsetzen lodert, weil er überlebte.

Ohne Worte und hoffentlich mit Einverständnis von James Nachtwey.
Wie kann man ergründen, wie das möglich war?
Wie war das möglich? Wieso ging die Saat der Hetze gegen die Tutsi und sogar gegen Huti, die nicht für ihre Vertreibung oder Ermordung waren, dermassen schrecklich auf? Reichte wirklich das Hate-Radio «Radio-Télévision Libre des Mille Collines» mit seiner unsägliche Hetze, seinen Aufrufen zum Gemetzel, dazu aus, die Huti (zu 40 Prozent Analphabeten) aufzustacheln und in einen Blutrausch zu treiben?
«Hotel Uganda» versuchte 2004, anhand einer wahren Geschichte die Ereignisse des Völkermords nachzuerzählen. Inklusive des so dramatischen Versagens der Weltgemeinschaft, dass einer der Befehlshaber der UN-Friedenstruppen im Land später Selbstmord beging. Aber «Hotel Ruanda» ist sehr Hollywood. Es gibt die Unschuldigen und die Bösen. Es gibt Helden, und am Schluss geht die Geschichte wenigstens für die Protagonisten gut aus.
«Black Earth Rising» ist ganz anders. Das fängt schon mit der Titelmusik an; einer der letzten Songs von Leonard Cohen, «You want it darker». Näher kann man mit Musik dem Tod nicht kommen. Aber auch nicht der Hoffnung auf Erlösung. Das setzt sich in einem Ensemble fort, das besser nicht hätte ausgesucht werden können.
Ein fantastisches Ensemble von Schauspielern
In erster Linie die unglaubliche Michaela Coel. Sie hat ein dermassen ausdrucksstarkes Gesicht, in dem sich alles auf ihre Augen, ihre Nase, ihre Lippen konzentriert, dass sie mit kühler Gelassenheit und Intellektualität das Grauen viel stärker macht. Und mit ihren (wenigen) Ausbrüchen, wenn sie zum Beispiel einem der ruandischen Kriegsverbrecher in seiner luxuriösen Villa begegnet, der tatsächlich die Stirn hat, ihr sein eigenes Leiden erklären zu wollen, lässt sie den Zuschauer verstört zurück.
Dazu John Goodman, so häufig in seichten Klamaukfilmen besetzt, der hier wieder einmal seine ganze schauspielerische Wucht als englischer Anwalt für Prozesse gegen Kriegsverbrecher ausspielt. Tamara Tuni, sonst in Polizeiserien unterwegs («Law and Order»), Harriet Walter, langjähriges Mitglied der «Royal Shakespeare Company». Bis in die Nebenrollen hinein grossartige Schauspieler, die niemals in den Fehler verfallen, angesichts dieses Themas ihre Rolle aus Betroffenheit zu überspielen. Overacting nennte man das.
Dazu ein fantastischer Drehbuchautor und Regisseur und Schauspieler
Schliesslich noch Hugo Blick, Drehbuchautor und Regisseur. Mir vorher unbekannt, seit dieser 8-teiligen Serie halte ich ihn für Oscar-würdig. Ohne Frage. Worum geht es hier, in der Art von «Der Nachtportier» nach dem Roman von John Le Carré aufgebaut? Es geht um die zufällig überlebende Ruanderin Kate Ashby (Coel), die von einer bekannten englischen Anklägerin vor dem Internationalen Gerichtshof adoptiert und aufgezogen wurde.
Nun arbeitet sie in der Anwaltskanzlei von Michael Ennis (Goodman), zusammen mit einer US-amerikanischen Staatssekretärin und einer ruandischen Nationalheldin ein Freundeskreis, der gemeinsam eine Absicht verfolgt.
In einer Nebenrolle Blick selbst, der sich dafür eine der widerlichsten Figuren ausgesucht hat. Einen englischen Anwalt, der den ruandischen Kriegsverbrecher verteidigt, der sich in Europa zur medizinischen Behandlung befindet und sich völlig sicher fühlt. Obwohl die vier Freunde, die eine gemeinsame Vergangenheit verbindet, seiner habhaft werden wollen. Zusammen mit Coel natürlich, die aber erst Schritt für Schritt eingeweiht wird.
Kein zur Belehrung erhobener Zeigefinger, keine moralische Lektionen
Aufgebaut ist das Ganze wie ein klassischer Thriller. Cliffhanger, Wendungen, Wahrheit wird zur Lüge, Lüge ist Wahrheit, was ist Gerechtigkeit, wer war schuldig, wer nur Opfer? Was für eine Rolle spielten die ehemaligen Kolonialmächte, Frankreich und England, welche Rolle die Coltran-Vorkommen in dieser Gegend, deren Ausbeutung und Wegtransport garantiert werden sollte?
Wer ist nun die von Coel umwerfend gespielte Adoptivtocher? Sie ist Ruanderin, natürlich. Sie wurde in einer Kirche unter einem Leichenberg gefunden, unter ihrer toten Mutter, unter ihrer toten Familie. Als sie dorthin zurückkehrt und die Kirche betritt, die als Mahnmal unverändert gelassen wurde, nur die Leichen wurden weggeschafft, ihre Kleider liegen nun auf den Kirchenbänken, fragt man sich, ob das als Film statthaft ist. Wenn man ein so guter Regisseur wie Blick und eine solche Ausnahmeschauspielerin ist, dann geht das.

Am Ort des Grauens. Aber auch Kate Ashby ist nicht die, die sie zu sein glaubt.
Allerdings brennt sich diese Szene, und nicht nur die, ins Gemüt auch wenig zartbesaiteter Menschen ein. Das kann man mir glauben; ich habe schon Leichenberge in echt gesehen.
Die Darstellung der Wirklichkeit als komplex macht den Film einzigartig
Grossartig machen den Film auch die geschliffenen Dialoge, gnadenlos, direkt, faszinierend. Nicht minder grossartig macht den Film, dass es kein Schwarzweiss gibt. Nirgends. Nicht bei den ehemaligen Kolonialmächten, wo es aufrechte Kämpfer für Gerechtigkeit und üble Schurken gibt, die keine alten Schuldgeschichten aufwärmen wollen. Und selbst die aktuelle Präsidentin von Ruanda akzeptieren, obwohl die sich verfassungswidrig zum zweiten und dritten Mal wiederwählen lassen will.
Weil sie der festen Überzeugung ist, dass nur sie das Land heilen kann, statt in die Vergangenheit zurück in die Zukunft führen, mit Hilfe westlicher Konzerne endlich die Profite aus dem Abbau von Rohstoffen in die Kasse Ruandas lenken. Dabei begleitet von einem Mastermind, einem sehr intelligenten Ratgeber. Man kennt sich schon lange, war auch einmal ein Paar. Aber auch er ist nicht das, was er zu sein scheint.
Nicht mal bei den Hutu und Tutsi sind die Rollen klar verteilt, es gab auf beiden Seiten Kriegsverbrecher und Massenmörder. In dieser Serie wird es dem Zuschauer nicht so leicht gemacht, dass er mit den Helden mitfiebert, um sie am Schluss glorreich triumphieren zu sehen. Im Gegenteil. Kaum etwas ist so, wie es am Anfang scheint, die Chefanklägerin samt einem anderen Kriegsverbrecher, den sie anklagt, der aber keiner ist, werden erschossen. Die übrigen Protagonisten werden von Krankheiten geplagt, die Hauptfigur ist schwer traumatisiert, muss ihre Ausbrüche mit Medikamenten unterdrücken.
Es geht darum: Die Suche nach Wahrheit und Gerechtigkeit ist gut. Selbst wenn sie schmerzhaft und traumatisch ist. Selbst wenn sie vieles als Lüge aufdeckt, was vorher als sichere Wahrheit galt. Aber: Wie viel Wahrheit verträgt der Mensch? Eine Gesellschaft? Wie kann man sich wieder versöhnen?
Wie kann man einen Völkermord verfilmen?
Auch zur Frage, wie er denn die Ursache des Traumas der Protagonistin darstellen soll, den Völkermord selbst, das Gemetzel, die rot gefärbten Flüsse, in denen wochenlang Leichen trieben, ist Blick eine grossartige Lösung eingefallen. Denn wie sollte er auch das von einem französischen Priester mitzuverantwortende Gemetzel in seiner Kirche filmen, dem die Filmfigur nur aus purem Zufall entkam; schwer verletzt, eigentlich auch dem Tod geweiht. Wenn nicht Zufälle, die das Leben bestimmen, sie gerettet hätten?
In Form einer Erzählung? In Form von fiktiven Szenen in einem Gerichtssaal? Oder gar real, sozusagen ein Blick in die afrikanische Ausgabe des KZ-Grauens? Nein, er hat sich für etwas anderes, Besseres entschieden. Diese Szenen sind schwarzweiss gezeichnet. Mit Symbolkraft, die durchaus an die Wirkung der Schauspieler heranreicht.

Der Moment ihrer Rettung unter den Leichen.
Ich finde: Wer sich für eine grossartig gemachte, gespielte, gefilmte, spannende und vielschichtige Darstellung eines unvorstellbaren Grauens interessiert, der muss unbedingt «Black Earth Rising» anschauen. Kleiner Ratschlag: mehr als zwei Folgen am Stück sollte man sich nicht antun. Dann braucht man eine Pause.