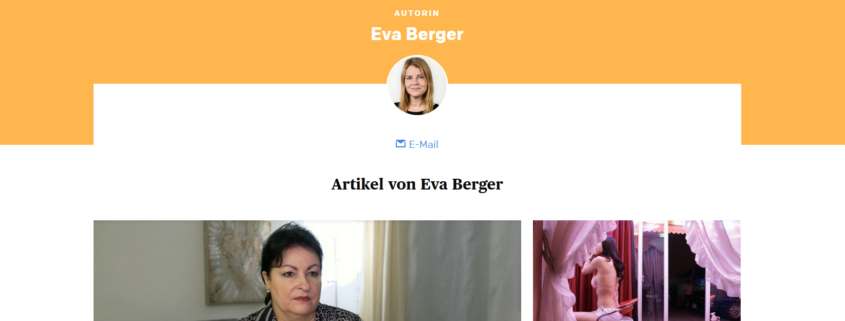Der Nebelspalter – eine Blattkritik
Das Cover der Novemberausgabe ist ein Ablöscher. Doch der «Nebi» punktet dann doch noch. So muss Markus Somm wohl nicht alles neu aufgleisen.
Der Nebelspalter gehört neu Markus Somm. Somm zeichnet sich, zumindest im wöchentlichen Gespräch mit Roger Schawinski, nicht unbedingt durch Humor, eher durch Verbissenheit aus. Bekommt er dank dem Nebelspalter nun mehr Gelassenheit und positiven Wortwitz?
Der 55-jährige war von 2010 bis 2018 Chefredaktor und von 2014 bis 2018 auch Verleger der Basler Zeitung. Nach dem Verkauf der BaZ von Christoph Blocher an Tamedia musste er den Chefposten abgeben. Seither schrieb er in der Sonntags-Zeitung eher belanglose Kolumnen mit oft weithergeholtem historischem Bezug. Markus Somm ist Sohn von Edwin Somm (87), der CEO von ABB Schweiz war. Ob der Nebelspalter Hauslektüre war bei Somms? Kennt Somm die aktuellen Ausgaben, oder verklärt er eher die Vergangenheit? ZACKBUM.ch hat die Novemberausgabe angeschaut.
Edles Papier, grottenschlechtes Cover
Der erste Eindruck: 68 Seiten, festes Papier, der Einband sogar noch dicker. Wenn schon ein recht teures Heft (Einzelpreis 11 Franken 80), dann wenigstens edel aufgemacht.
Aber: Das Cover ist leider einfach nur schlecht. Der «lustige» Cartoon ist viel zu fein gezeichnet für ein Titelbild. Erst auf den zweiten Blick checkt man, worum es geht. Maskenpflicht im Himmel. Petrus gibt an der Pforte eine Maske ab. Geht so.

Machen die Textanrisse mehr Lust?
Das Wortspiel «Tor des Monats: Thomas Klür» ist so etwas von altbacken.
Kosmetik: Die Fassade bröckelt unaufhaltsam. Auch eher ein Altherrenwitz.
US-Präsidentschaft: Die erste Wahl, die nur Verlierer kennt. Könnte auch in der NZZ stehen.
Konzernverantwortung: Jetzt hat das Volk die Qual der Moral. Ja gut, der geht einigermassen.
Fazit: Viel Moralin, fast kein Wortwitz. Gähn! Der Nebelspalter nennt sich selber «eine Schweizer Satirezeitschrift». Aber wo bleibt da der satirische Ansatz?
Im Fernsehen würde man wohl wegzappen. Aber weil der Nebelspalter doch schon 145 Jahre lang rauskommt, ist der Respekt zu gross.
Irre lange Vorlaufzeit der Inhalte?
Das Editorial von Marco Ratschiller lässt tief blicken. «Noch bevor sich die Corona- Pandemie auf der Welt ausgebreitet hatte, war für diese Ausgabe das Schwerpunktthema Exit vorgesehen». Ein Jahr Vorlaufzeit? Das wird Markus Somm wohl noch genauer anschauen. Und ja, das Thema Exit wäre so dankbar für einen rabenschwarzen Comic auf der Titelseite. Wo blieb der Mut von Chefredaktor Ratschiller? Ok, ok. Weiter unten im Editorial erklärt er, das Titelbild sei die BAG-konforme Parodie auf ein berühmtes Gemälde von Hieronymus Bosch. Ach so.
Auf Seite vier begegnet uns ein alter Bekannter. Miroslav Bartàk. Der Cartoonist mit Jahrgang 1938 ist seit ewig dabei beim Nebelspalter. Man kennt ihn auch von der Weltwoche. Nun wird die Bande dank dem SVP-Gespann Somm und Köppel noch enger. Für Simon Ronner und Co: Ja, Herr Somm ist offiziell FDP-Mitglied.
Beim Inhaltsverzeichnis ist speziell, dass der Code fürs E-Paper und fürs PDF-Archiv früherer Ausgaben abgedruckt ist. Achtung Spoiler!!! Ob es wohl viele Sparfüchse gibt, die einfach schnell in den Bahnhofkiosk pilgern und sich das Login «Masken» und das Passwort «Pflicht» merken?
Auf Seite 6 fällt die Rubrik «Wortschatz» auf mit dem Logo «Nebipedia». Max Wey doziert über den Begriff «Luftbuchung», wie das wohl nur ehemalige Korrektoren können. Witzig ist anders. Es wird wieder einmal klar: Das Wort korrekt kommt vom Wort Korrektor. Max Wey schreibt übrigens hin und wieder – für die Weltwoche.
Nun kommt also der «Tor des Monats». Swiss-Chef Thomas Klür. Das gezeichnete Portrait von Michael Streun ist gelungen. Die Würdigung von Marco Ratschiller weniger. Sie ist zum Teil anklagend, zum Teil ironisch gemeint. Für diesen Aufsatz bekommt der Chefredaktor eine Viereinhalb. Thema nicht ganz getroffen.

Erinnerungen an René Gilsi
Dafür ist «Die Geschichte zum Bild» von Daniel Kaufmann mit ziemlich beissendem Humor geschrieben. Ein Seitenhieb auf eine SRF-Rundschau-Reportage. Sehr gut.
Ganz in der Tradition der kritischbösen «Nebi»-Cartoons dann jener von Marina Lutz. Erinnerungen an René Gilsi (1905 bis 2002) werden wach. Gilsi war eine schweizweit geachtete Persönlichkeit, der mit seinen politischen Karikaturen Generationen von Nebi-Lesern prägte.

Gelungen ist trotz einer gewissen zeitlichen* Distanz die Doppelseite über Joe Biden und Donald Trump mit einer Vorschau aufs 2021 im Sinne von «was wäre wenn». Gut gemacht, Ruedi Stricker.
*) die Dezembernummer kommt heute Freitag raus, die Novembernummer ist also bei dieser Blattkritik 0,9999 Monate alt.
Auch die ganzseitige Karikatur von André Breinbauer «Belarus: Leiden unter Lukovid» ist sehr ansprechend. René Gilsi hätte seine liebe Freude.
Erste Sahne die Bildergeschichte von Oliver Schopf. Knusper-CRISPR-Krone. Eine witzige Verballhornung der Wissenschaft. Macht wegen dem Zeichungsstil den Nebelspalter-Leser grad gefühlte zehn Jahre jünger.
Die Rubrik «Fertig lustig» von Hans Durrer ist dann eher wieder ein Mottenkisten-Text. Man googelt Tod, Zitate, berühmte Leute, Satire. Fertig.
Exit-Travel – so sollte Satire sein
Besser geraten der Text Exit-Travel von Hans Abplanalp. Er schöpft beim Thema Abschlussreise aus dem Vollen. Zur Auswahl stehen ein Militär-Trip zu den Talibans ohne gepanzerte Weste und Waffe, eine aktive Teilnahme an einer Steinigung oder ein Basketballmatch gegen Kim-Jong-un. Gewinnst Du das Spiel, musst Du nur zwei Jahre ins Arbeitslager.
Das Interview mit Bundespräsidentin Sommaruga ist ebenfalls noch ganz lustig. Zumindest um Längen besser als die ärgerlichen Fiktiv-Interviews von Andreas Thiel in der Weltwoche. Und: Das Sommaruga-Interview ist am Schluss sogar leicht selbstironisch.
********************
Frau Präsidentin des Bundes, vielen Dank für dieses Interview.
Von welchem Magazin sind Sie?
Vom Nebelspalter.
Gibt’s den noch?
********************
Sehr gut, Oliver Hepp. Sie dürfen bleiben.
Wiedersehen mit Horst Haitzinger
Und nun. Eine meiner Lieblingsrubriken. «Aus dem Nebelspalter-Archiv». Wobei. Seit René Scheu (NZZ) mir einen strukturkonservativen Geist, der gerade unter Medienkritikern notorisch zu sein scheint, attestiert hat, bin ich nachdenklicher geworden. Aber sei’s drum.
Denn endlich gibt’s ein Wiedersehen mit dem berühmten Österreicher Horst Haitzinger. Der 1939 geborene Karikaturist hat laut Wikipedia über 16000 Karikaturen veröffentlicht. Diesmal ist er vertreten mit zwei etwa 40-jährigen Beiträgen zum Fight zwischen Jimmy Carter und Ronald Reagan.
Ziemlich amüsant (ohne Ironie!) ist die Seite mit den amtlichen Mitteilungen. Diesmal ein Testament mit feinen Spitzen. Rheinmetall, Rolf Knie, Militär, Albert Anker, Christoph Blocher. Herrlich, wie auch die fiktiven Inserate. Ruedi Stricker, bitte mehr davon.
Nun folgen mehrere Seiten zum Thema Kosmetik. Politisch schön unkorrekt pinkfarbig gekennzeichnet, wirken die Textchen aber doch recht aufgesetzt. Interessanterweise setzen sich ausnahmslos männliche Autoren mit dem Thema auseinander. Fazit: verstaubt und aus der Zeit gefallen. Dazu passt ein Kellner-Kalauer, der auch irgendwo vorkommt.
Doch auf Seite 53 wird’s wieder frischer. Poetry Slam! Marguerite Meyer beschreibt, wie ein satirischer Text kläglich scheitert. Das macht sie super! Obwohl. Eine Seite darüber schreiben, dass einem nichts einfällt. Das kann man natürlich nur einmal.
In der Textbox wird dann klar, warum Marguerite Meyer nichts einfällt. Sie arbeitet beim Online-Magazin Republik. Das ist nun aber Realsatire. Denn die Medien kommen praktisch nicht vor im Nebi. Eine ironische Medienschau wie in der WoZ oder in der Sonntagszeitung sucht man vergebens.
Trotzdem scheint der Nebelspalter nun irgendwie an Fahrt aufzunehmen. Die Glosse von Thomas C. Breuer über das Bergell macht wegen den vielen Wortspielereien echt Freude. Auch die Kolumne von Lisa Catena, eine Carte blanche zum Thema «Experten», ist gelungen.
Die Rubrik «Für Sie erlebt» ist ebenfalls recht witzig. Die freien «Nebi»-Autoren erzählen im Stil von Leserbriefen, was sie so erlebt haben. Alltagshumor, den man liebt in drögen Coronazeiten.
Gut gefällt auch die Rubrik «Leute von heute». Was aber im ganzen Heft auffällt: Auf den Mann, respektive auf die Frau wird selten gespielt. Politiker, Showstars, SRF-Mitarbeiter kommen ungeschoren davon. Darum wirkt das Heft alles in allem recht unpersönlich. Liegt der Grund in der langen Vorlaufszeit? An der Beissheimmung?
Immerhin hat auf Seite 63 Andreas Thiel dann doch noch seinen Auftritt. Sein Portraitfoto mit neuer Frisur ist richtig sympathisch. Warum tritt er in der Weltwoche immer noch mit seinem Irokesenschnitt in Erscheinung? Auch sein Text ist besser als das ausgelutschte Frage-Antworten-Pingpong in der Weltwoche.
Die «letzten Meldungen» auf Seite 54 sind köstlich. Ob der nicht mehr genehme Uncle Ben auf der Reispackung oder die Frage, ob die «Mitte» immer noch Durchschnitt bleibe, Roland Schäfli hat das Handwerk der Satire verstanden.
Und dies noch aus der Rubrik «Das Allerletzte»:
Aldi-Werbung:«Meh als Aktivferien.» Wenn Deutsche glauben, Schwyzerdütsch zu können: «Meh wie Aktivferien», bitte!
Das Blattkritik-Fazit: Der Nebelspalter ist weniger angestaubt als befürchtet. Und Markus Somm darf sich freuen. Linksdrall hat das Blatt definitiv nicht. Ausmisten scheint also nicht angesagt. Ausser, Herr Somm will ein SVP-Kampfblatt daraus machen. Aber das hat er ja auch bei der Basler Zeitung dann doch nicht gewagt.