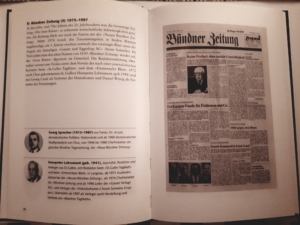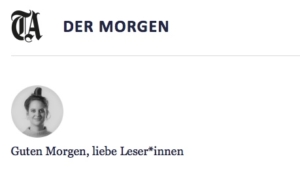Emma ist immer für Euch da
Ein abschreckendes Interview reicht nicht. Da muss ein zweites her.
Über 500 Treffer in den letzten sechs Monaten zeigt die Datenbank SMD, wenn man Emma Hodcroft als Suchbegriff eingibt. Das letzte Mal wurde sie bei Tamedia als Antwort auf ein Interview des völlig unbekannten WHO-Sondergesandten in Sachen Corona von CH Media in Stellung gebracht.
Die Erkenntnisse hielten sich aber in sehr überschaubaren Grenzen. Auf der anderen Seite ist dieser Auftritt schon fast einen Monat her, und Hodcroft steht seit Ende November in scharfer Konkurrenz. Denn seither arbeitet sie als Postdoktorandin am Institut für Sozial- und Präventivmedizin der Uni Bern.
Da schiebt sich Christian Althaus in die öffentliche Poleposition; als Twitter-King aller Corona-Unken, als jemand, der 2000 Tweets später gelernt hat: Sag’s einfach, sag’s aufregend, sag’s düster. Und zähle drauf, dass du damit in die Medien kommst; welchen neuen Quatsch du erzählt hast, interessiert morgen keinen mehr.
Da muss Hodcroft, die (noch) nicht Mitglied der grossartigen Taskforce to the Bundesrat ist, natürlich antreten. Aber Twitter ist ziemlich besetzt, da können es nur zusätzliche, regelmässige, lange, langfädige, langweilige Interviews tun.
Während die anderen erschlaffen, grätscht Hodcroft rein
Nun gibt es scheint’s eine – völlig übliche – Mutation des Corona-Virus, und irgendwie haben sowohl Salathé wie Althaus wie die Taskforce den Einsatz verpasst. Da grätscht natürlich Hodcroft hinein.
Denn die bange Frage ist: Gibt’s die Mutation auch schon in der Schweiz, oder kommt sie demnächst? Leider weiss auch Hodcroft nichts Genaueres, aber immerhin ist sie Epidemiologin, das reicht doch, um mit einer neuen Nullaussage in die Medien zu kommen: die neusten Genomanalysen in der Schweiz stammten vom 19. November und umfassten nur eine kleine Auswahl an Covid-Patienten.
Dennoch vermutet Hodcroft, dass das Virus
«möglicherweise bereits in der Schweiz» sei.
Mit dieser Hammer-Erkenntnis schafft sie es immerhin in so ziemlich alle Medien; von SRF über «watson», «20 Minuten», NZZ und immer wieder ins Newsnet von Tamedia. Denn die Thematik «impfen, und wenn ja, warum nicht oder so?» braucht natürlich auch fachmännischen Ratschlag.
Die Taskforce verteidigt ihre Stellung – mit 100 Tweets
Und wer mal in der Pole-Position sitzt, wenn spätestens der Chefredaktor verlangt: Da muss noch eine Expertenmeinung her, bei dem klingelt es ständig in der Mailbox. Und da weder Hodcroft noch ihre Genfer Konkurrentin Isabella Eckerle in der Taskforce sitzen, twittern auch sie, was das Zeug hält.
Denn obwohl sich die Taskforce eigentlich jeder öffentlichen Stellungnahme – ohne Rücksprache mit dem BAG – enthalten sollte, twittern ihre Mitglieder munter drauflos; fast 100 Tweets – pro Tag. Dagegen versucht Hodcroft, mit Emotionalität anzukämpfen; so bemerkte die NZZ in einer grossen Untersuchung des Twitterverhaltens von Wissenschaftlern bei ihr spitz: «Emma Hodcroft klärt uns unter anderem über ihre Pläne für den Weihnachtsrummel auf, und sie lässt uns am Schicksal ihres Laptops teilhaben.»
Dass jeder Wissenschaftler – und auch jede Wissenschaftlerin – einen Platz an der wärmenden Sonne medialer Aufmerksamkeit sucht, ist menschlich verständlich. Karriere, Forschungsgelder, Wichtigkeit. Wieso angebliche Qualitätsblätter ihnen aber immer wieder Gelegenheit zum Luftbacken geben, das ist unverständlich.
Wir holen uns ein paar Nullaussagen ab
Janine Hosp, die aktuelle Interviewerin, ist seit 25 Jahren bei Tamedia. Mehr Qualifikation für ein Epidemie-Interview ist nicht zu erkennen. Aber Hodcroft macht es ihr auch leicht. Denn sie sagt mit wissenschaftlicher Klarheit:
«Niemand will einen harten Lockdown. Aber wenn das mutierte Virus tatsächlich in der Schweiz entdeckt wird und sich rasch ausbreitet, dann werden wir wohl keine andere Wahl mehr haben.»
Das schafft nur eine Postdoktorandin: Ein Satz mit drei Konjunktiven oder Relativierungen. Damit ist er ungefähr so aussagekräftig wie dieser Satz: Wenn morgen Wolken entdeckt werden und sich rasch ausbreiten, dann werden wir wohl keine andere Wahl haben, als die Regenschirme aufzuspannen.
Liebe verzweifelte Redaktoren: Man muss auch mal den Mut zur Lücke haben. Dank 25-jähriger Karriere kann sich Hosp sicher noch erinnern: Es gab mal Zeiten, da wurde ein unergiebiges Interview einfach gespült, dem Leser erspart. Heute wird er lieber damit gequält; Leistung, Output, Klickzahlen.