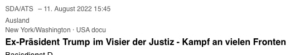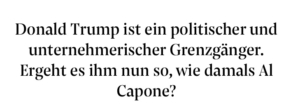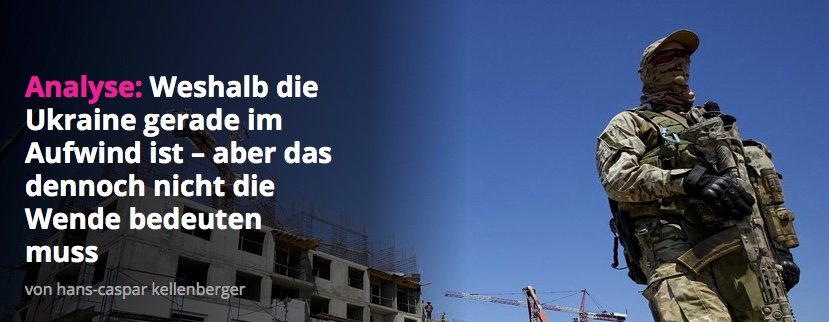Die grossen Schweiger der Postfinance
Rufen Sie nicht an. Schreiben Sie auch nicht. Wir antworten nicht.
Die Eigenwerbung kommt geschleckt daher: «PostFinance gehört zu den führenden Finanzinstituten der Schweiz und ist für über 2,6 Millionen Menschen die zuverlässige Partnerin für Privat- und Geschäftskunden, die ihre Finanzen selbstständig verwalten möchten.»
Über 3200 Mitarbeiter bemühen sich angeblich bei der systemrelevanten Staatsbank darum, «Ihnen den Umgang mit Geld so einfach wie möglich zu machen». Das ist der schöne Schein. Dahinter verbirgt sich aber ein hässliches Sein.
Nach zehn Tagen brandschwarzer Lüge, dass die Postfinance eine Überweisung aus den USA nicht bekommen habe, räumte die Bank ein, dass das Geld doch bei ihr angelangt sei. Durch eine kleine publizistische Offensive sah sich die Postfinance dann dazu gezwungen, telefonisch die Erklärung nachzuschieben, dass der Betrag nicht auftragsgemäss dem Kunden gutgeschrieben wurde, weil es hier eine «Sanktionsproblematik» gebe.
Auf den Hinweis, dass das schlecht sein könne, weil weder der Absender, noch die beteiligten Banken, noch der Empfänger nachweislich auf irgend einer Sanktionsliste stünden und man das problemlos einsehen könne, verstummte das Finanzinstitut.
Die Compliance-Mitarbeiterin wollte nicht mal ihre E-Mail-Adresse rausrücken und warnte mündlich, dass die nötige «Überprüfung» noch ein Weilchen dauern könne und man von täglichen Anrufen absehen solle.
Der frustrierte Kunde folgte dann ihrer Anregung, er solle sich doch, wenn ihm das nicht passe, mit einer Beschwerde an den CEO der Postfinance wenden. Also bekam Hansruedi Köng ein Beschwerdeschreiben. Und schweigt.
Die mit einigen journalistischen Fragen angeschriebene Medienstelle teilte knapp mit, dass sie diese Fragen an das «Beschwerdemanagement» weitergeleitet habe. Das sei aber nicht der Sinn der Anfrage gewesen, stocherte der Kunde und Journalist nach. Seither schweigt die Medienstelle.
Natürlich schweigt das «Beschwerdemanagement» auch. Ein freundlicher Tippgeber enthüllte die Mail-Adressen der Rechtsabteilung und der Compliance der Bank. «legalpf@postfinance.ch» und «compliancepf@postfinance.ch». Raffiniert, darauf muss man erst mal kommen, mit dem angehängten pf hält man sich ungebetene Belästigungen durch Kunden vom Leib.
Auch diese Instanzen wurden angeschrieben und – Überraschung – schweigen. Eine weitere Möglichkeit, mit der Postfinance in Kontakt zu treten, ist ihre einzige und gebührenpflichtige Telefonnummer. Hier schweigt sie nicht, sondern berieselt den Anrufer minutenlang mit Dudelmusik und dem Hinweis, dass leider alle Mitarbeitenden im Gespräch seien. Wer das übersteht, kann dann tatsächlich mit einem lebenden Menschen sprechen. Nur: der weiss von nix und versteht von Bankgeschäften oder gar Überweisungen nix. Ein Call-Center-Mitarbeiter der Post weiss immerhin, was bei einem Päckchen die Tracking-Nummer ist. Ihre Geldentsprechung UETR ist für Postfinance-Angestellte hingegen Bahnhof. Nix verstan.
Der Gerechtigkeit halber sei noch angefügt, dass man ganz modern auch chatten kann mit der Postfinance. Vorausgesetzt, man verfügt über E-Banking und eine Engelsgeduld. Denn zuerst muss man sich hier durch einen Chat-Bot arbeiten, ein automatisiertes Programm, das auf vernünftige Fragen bescheuerte Antworten gibt. Und einem erst nach einem kräftigen Nein auf die abschliessende Frage, ob die Antworten genützt hätten, verspricht, den Kunden an ein menschliches Wesen weiterzuleiten.
Nun bedeutet Chat eigentlich, dass schriftlich ein Gespräch geführt wird, Frage, Antwort, Frage, Antwort. Bei der Postfinance nimmt man es aber gemütlich. An dieser Stelle des Chats wird lediglich versprochen, dass «innert zwei bis fünf Arbeitstagen» mit einer Antwort zu rechnen sei. Daran hielt sich die Postfinance immerhin in diesem konkreten Fall. Nur: die Antwort war falsch.
Ach, dann gibt es ja noch reale Filialen der Postfinance. Wenn der Kunde persönlich dort aufschlägt, wird er sogar ausnahmsweise ohne vorherige Terminvereinbarung empfangen. Bedient wäre dann wohl das falsche Wort, denn der Postfinance-Mitarbeiter weiss auch nach einem Blick in seinen Bildschirm nichts Genaues. Auf die Frage, ob er sich nicht vielleicht intern erkundigen könne, gibt er die verblüffende Antwort, dass auch er nur die gleiche Telefonnummer habe wie der Kunde.
Der Angestellte reiht sich in die gleiche Warteschlaufe wie 2,6 Millionen Postfinance-Kunden ein, das ist wohl weltweit einmalig.
Nun wäre das alles brüllend komisch, wenn die Post nicht seit inzwischen 15 Tagen auf einem recht ansehnlichen Geldbetrag sitzen würde, den sie eigentlich im Auftrag des Absenders dem Kunden hätte gutschreiben sollen. Aber aus reiner Willkür, ohne rekursfähige schriftliche Begründung, haftungsfrei und verantwortungslos hat sie sowohl dem Absender wie dem Empfänger die Verfügungsgewalt über deren Geld entzogen.
Da müsse zuerst eben eine «Sanktionsproblematik» abgeklärt werden. Nicht etwa von der Postfinance, sondern von einer nicht näher genannten staatlichen Behörde, die aber überarbeitet sei, weshalb das eine unbekannte Zeitspanne lang dauern könne.
Wer die Hand auf ihm nicht gehörendes fremdes Gut legt, ohne das rechtlich wasserdicht begründen zu können, wird normalerweise als Dieb bezeichnet. Natürlich darf man diesen Ausdruck nicht auf die Postfinance anwenden, sonst würde man sicherlich eher schnell etwas von der Rechtsabteilung hören. Zudem kann die Postfinance ja behaupten, dass sie das Geld nicht etwa verfrühstücken will, sondern nur beschlagnahmt, eingefroren hat, kommissarisch verwaltet.
Selbstverständlich nur im Dienst des Kunden, um dessen Wohlergehen bemüht und besorgt.
PS: Zeichen und Wunder. Weiterhin verkniffen schweigend hat die Postfinance am Freitagnachmittag die Überweisung gutgeschrieben. Eine Mitteilung, eine Entschuldigung gar? Irgend eine geheuchelte Anteilnahme, wenigstens das übliche Gequatsche: ist nicht ganz optimal gelaufen, bitten um Verständnis, werden die Abläufe überprüfen? Ach was, die Postfinance doch nicht. Das wäre doch kundenfreundlich, und das geht gar nicht.