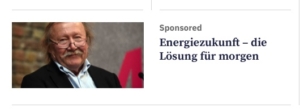Erhabener Quatsch
Westentaschen-Philosophie im Qualitätskonzern Tamedia.
Der normale Tamedia-Journalist ist nur durchschnittlich peinlich. Gut, es gibt Ausnahmen wie Loser oder Tobler, aber auch sie kommen nicht über die Kategorie «schweres Fremdschämen» hinaus. Die Gazetten sind allerdings, mangels Eigenleistungen, und wirklich alles kann man auch nicht aus München übernehmen, von Kolumnitis befallen.
Also keiner zum klein, Kolumnist zu sein. Das gilt auch für keine. Das gilt besonders für die Westentaschen-Philosophin Barbara Bleisch. ZACKBUM ist sich sicher: hätte sie ein anderes Geschlecht, sie wäre schon längst entsorgt worden. Das hätte allerdings zur Voraussetzung, dass es noch ein Qualitätsmanagement und/oder einen minimalen Qualitätsanspruch gäbe.
Da es den nicht gibt, wird der zahlende Leser hiermit gequält:

Schon der Titel ruft: lies mich nicht. «Post-Ferien-Kater»? Abgesehen von der geholperten Form: kann man im Zeitalter der korrekten Genderei überhaupt noch Kater verwenden?
Aber gut, der Leser ist vorgewarnt, wer sich dennoch auf den Text einlässt, wird nicht enttäuscht: der Adrenalinspiegel steigt, man greift sich an den Kopf, man ist kurz belustigt, dann ernsthaft beleidigt. Und fühlt sich bemüssigt, Schmerzensgeld einzufordern. Jeder ist selber schuld, wenn er auch noch den ersten Satz übersteht: «Seit Montag hat uns die Scholle wieder.» Nein, sie meint damit nicht den Goldbutt, sondern ein Stück Erde. Als ob die Leser alle Bauern wären.
Dann lässt sich die Schande für den Begriff Philosoph darüber aus, dass alle Ratschläge, wie man am Arbeitsplatz Ferienstimmung bewahren könne, nichts nützen. Erkenntniswert bis hier: null. Unterhaltungswert: minus eins. Aber dann wird’s noch schlimmer, denn Bleisch erinnert sich auch in dieser Kolumne plötzlich daran, dass sie ja eigentlich als «Philosophin» schreiben sollte. Und die Hälfte des Platzes hat sie schon mit luftleeren Allgemeinplätzen gefüllt.
Nun aber, der Aufschwung: «In der Philosophie ist in diesem Zusammenhang von der Kategorie des «Erhabenen» die Rede.» Wow. Erhabenheit hat zwar null und nix mit einem «Post-Ferien-Kater» zu tun, aber nach einem Blick in Wikipedia unter das entsprechende Stichwort kann Bleisch mit Namen klimpern: «Erhabenheit hat, wie man beispielsweise bei Edmund Burke oder Immanuel Kant nachlesen kann ...»
Denn worum geht’s? Erhabenheit habe «mit der Erfahrung überbordender Quantität zu tun: mit der unendlichen Weite des Ozeans, der überwältigenden Tiefe einer Schlucht, der gigantischen Grösse eines Dschungels, dem endlosen Sternenhimmel über uns». Ist doch praktisch, dass in Wikipedia die Entwicklung des Begriffs von der Antike bis Burke und dann ab Kant dargestellt wird. Leider hat Bleisch aber nicht weitergelesen, was Kant denn über den Ozean sagt:
«So kann der weite, durch Stürme empörte Ozean nicht erhaben genannt werden.»
Ups.
Dass sie dann Hegel, Schiller, Adorno und das Erhabene in der Musik aussen vor lässt – es sei ihr verdankt, denn mehr erträgt der philosophisch ein wenig gebildete Leser wirklich nicht.
Aber Bleisch hat ja im Holper-Titel noch Rezepte versprochen; wunderbar, dass sie noch ganz am Schluss sich daran erinnert. Da muss der Leser noch ein letztes Mal ganz stark sein, tief einatmen, Nase zuhalten und durch:
«Wer in den Ferien dem Gefühl des Erhabenen auf der Spur war, wird im Alltag die Ehrfurcht vermissen, die einen beim Anblick schneebedeckter Alpenketten, weiter Täler und endloser Ozeane erfüllt. Zurück im Büro helfen dann am ehesten ein Paar Kopfhörer und Beethovens Fünfte, gern brechend laut. Mit einem guten Beamer lässt sich abends ausserdem die Wohnung mit David Attenboroughs atemberaubenden BBC-Naturfilmen fluten. Beides reicht vielleicht nicht ganz an die Erhabenheit in wilder Natur, dürfte die Dimensionen aber zumindest kurzfristig wieder zurechtrücken und den Ferienkater vertreiben.»
Was ist eigentlich das Gegenteil von erhaben? Vielleicht lächerlich, erbärmlich, niedrig. Oder aber, wir haben ein neues Antonym entdeckt, um es mal hochstehend bis hochtrabend auszudrücken. Das Gegenteil von erhaben ist «Bleisch-Kolumne».