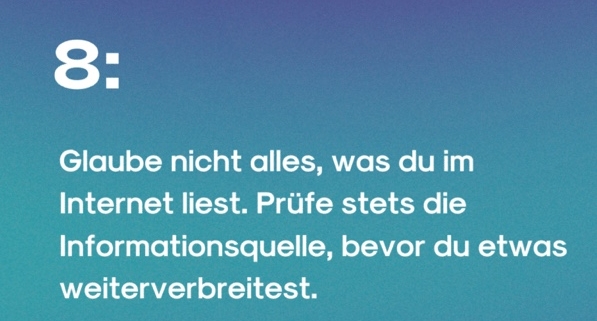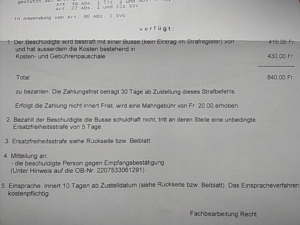Geschäftsgelaber
Wenn die «Republik» einen Geschäftsbericht schreibt. Und schreibt. Und schreibt.
Das ist mal eine Ansage: «Wir legen alles offen: unsere Finanzen, Arbeitsweisen, Fehler, Löhne – weil wir überzeugt sind, dass Transparenz wichtig ist.»
Wunderbar; überprüfen wir das doch am aktuellen Geschäftsbericht 2021/2022: «Was Sie schon immer über die Republik wissen wollten». Vielleicht will man gar nicht so viel wissen. Denn immerhin 11 Nasen (plus eine Revisionsgesellschaft) brauchte es, um 55 Seiten vollzulabern. Das ist immerhin weniger als ein GB der CS oder der UBS. Aber doch Lektüre satt.
Schon im «Editorial» wird der düster-dräuende Ton gesetzt, der eigentlich alle Machwerke des Magazins auszeichnet:
«In den USA, aber auch in Europa hebt der Faschismus sein Haupt, in der Ukraine herrscht Krieg, Russland droht dem Westen mit Atomschlägen, die Inflation kehrt zurück, die Pandemie ist zwar aus den Schlagzeilen verschwunden, aber nicht aus der Atemluft, die öffentliche Debatte ist voller Dummheiten und Gereiztheit – und das ehemals harmloseste Gesprächsthema, das Wetter, verlor seine wohltuende Belanglosigkeit.»
Schlimme Zeiten; gut, dass es die «Republik» gibt. Meint die «Republik». Dieser Ansicht schliessen sich aber immer weniger Leser, Pardon, «Verleger», an. Dafür verordnet sich die Crew klare Massnahmen: «Diesen Trend gilt es umzukehren.» Das hört sich nun doch nach CS an.
Auch im besten Bankertalk werden gute Nachrichten verkündet: «Der Zielwert für die Gewinnung neuer Mitglieder lag bei rund 4800. Erreicht haben wir 5462.» Das wäre wunderbar, aber: «Parallel dazu verloren wir jedoch 4973.» Das bedeutet netto ein Plus von 489 Abos.
Immerhin fasst die «Republik» für den nicht bilanzsicheren Leser ihre Zahlen in einer «Milchbüchleinrechnung» zusammen: 6,91 Millionen Einnahmen, 6,84 Millionen Ausgaben, davon fast 5 Millionen fürs Personal, macht einen Überschuss von haargenau 64’908 Franken. Minus «Rückstellungen für Steuern» von 930’000, bleibt ein Defizit von rund 865’000 Franken.
Jetzt kommt eine Formulierung, die die Corporate Communication einer Bank auch nicht besser hingekriegt hätte: «Im vergangenen Jahr haben wir festgestellt, dass ein Teil der Spenden aus den Jahren 2017 bis 2020 wahrscheinlich als Schenkungen zu qualifizieren sind, auf die Schenkungssteuern anfallen. Zudem hat die Project R Genossenschaft zwischen 2017 und 2021 Zahlungen an die Republik AG getätigt, um die Ausbildung von Journalistinnen und grosse Recherchen zu finanzieren, die möglicherweise mehrwertsteuerpflichtig sind. Entsprechende Nachdeklarationen sind zum Zeitpunkt des Jahresabschlusses bei den Steuerverwaltungen eingereicht, um gegebenenfalls anfallende Steuern nachträglich zu bezahlen.»
Liebe Leute: «Im vergangenen Jahr haben wir festgestellt»? Das ist nun eindeutig eine Beleidigung der Intelligenz aller Leser dieses Geschäftsberichts.
Dann folgt seitenlange Selbstbespassung mit ausgewählten Texten und Fotos, ab Seite 30 dann Bespassung mit kommentarlosen Fotos aller «Crew»-Mitglieder und des «Genossenschaftsrats».
Ab Seite 39 folgt dann endlich der durchaus professionell aufgemachte «Finanzbericht». Bei der Rubrik «Kurzfristige Rückstellungen» wird nochmals mit Sternchen diskret auf zwei Punkte hingewiesen:
«* Diese Rückstellungen beziehen sich auf Spenden aus den Jahren 2017 bis 2020 an die Project R Genossenschaft, die wahrscheinlich als Schenkungen zu qualifizieren sind.» Und: «** Diese Rückstellungen beziehen sich auf Zahlungen aus den Jahren 2017 bis 2021 der Project R Genossenschaft an die Republik AG, die wahrscheinlich mehrwertsteuerpflichtig sind.»
Interessant ist zwischendurch auch die Auflistung der Darlehen. Angeführt von den Gebrüdern Meili mit 1,13 Millionen Franken schiebt die «Republik» hier einen Schuldenberg von insgesamt 2,41 Millionen Franken vor sich her. Einzig gute Nachricht: er ist im Vergleich zum Vorjahr nicht gewachsen.
Wenn man den «übrigen Personalaufwand» von rund 100’000 Franken (grösstenteils Spesen) ausser Acht lässt, hat die «Republik» 4,8 Millionen Franken für 46 Mitarbeiter (vier mehr als im Vorjahr) rausgehauen. Interessant ist hier der Posten «Mandatsleistungen und Aushilfspersonal» von immerhin 172’786 Franken, fast eine Verdreifachung zum Vorjahr.
Abgerechnet werden hier insbesondere «Mandatsleistungen von Verwaltungsrats- und Vorstandsmitgliedern in der Höhe von CHF 169’465 (Vorjahr CHF 60’931).» Happig, happig.
Beim «Verwaltungs- und Informatikaufwand» sind dann nochmals 167’165 Franken für «übrige Beratungsdienstleistungen» aufgeführt. Ein Sternchen erklärt: «Darin enthalten sind im Berichtsjahr Aufwendungen für die Revision in der Höhe von CHF 46’207 (Vorjahr CHF 40’049) sowie Rückstellungen in der Höhe von CHF 35’000 für noch nicht abgeschlossene juristische Verfahren.»
Bleiben noch rund 86’000 für Dies-und-das-Beratungen. Insgesamt liess sich die «Republik» also ganz allgemein für immerhin 256’000 Franken «beraten», pro Monat waren das 21’333 Franken.
Schliesslich bestätigt die Revisionsgesellschaft BDO, dass in der Konzernrechnung alles mit rechten Dingen zu und herging. Allerdings ringt sie sich eine Anmerkung ab: «Wir machen auf die Anmerkung zur Fortführungsfähigkeit im Anhang zur Konzernrechnung aufmerksam, wonach eine wesentliche Unsicherheit an der Fähigkeit des Konzerns zur Fortführung besteht.»
Das heisst auf Deutsch: Feuer im Dach, Eigenkapital im roten Bereich, au weia.
Aber buchen wir das mal unter der Vorsicht einer Revisionsbude ab. Viel bezeichnender ist, dass sie keinerlei Anmerkung zu einer Rückstellung von fast einer Million für «plötzlich» festgestellte mögliche Steuernachzahlungen macht.
Will die «Republik» (und die BDO) wirklich ernsthaft behaupten, dass angesichts dieser Beratungskosten, angesichts der Tätigkeit von ausgewiesenen Finanzcracks es tatsächlich so sei, dass all diese Fachleute Jahr für Jahr die Steuerrechnung durchwinkten und für korrekt befanden – um sich dann plötzlich am Hinterkopf zu kratzen und zu sagen: ui, könnte es sein, dass wir vielleicht nicht alles ordentlich versteuert haben?
Das, liebe Republikaner, würdet Ihr doch keiner Firma abnehmen, die Euch vor die journalistische Flinte läuft. Daraus würdet Ihr doch einen Riesenskandal hochzwirbeln. Das wäre für Euch doch ein Beispiel dieser schweinebackigen Versuche, mit cleveren Beratern alle Lücken, Grauzonen und Schlaumeierein auszutesten, die es ermöglichen, Steuerzahlungen so gut wie möglich zu minimieren, zu vermeiden.
«Wir legen alles offen», «Transparenz ist wichtig». Einverstanden. Aber zu Transparenz gehört auch die Erklärung, wie dieser Skandal möglich wurde. War es wirklich Schlamperei, ein «Formfehler»? Shit happens? Kommt in den besten Buchhaltungen vor? Oder war es Absicht? War es «wir probieren’s mal»? War es «wenn’s keiner merkt, ist’s doch super»?
Da erwarten wir doch sehr gerne vollständige Transparenz. Und nicht erst in einem halben Jahr, sondern noch vor der anstehenden Abo-Erneuerungsphase ab Januar …