Was geht in Hirnen unter Haaren vor?
Früher litten Langhaarige, heute Dreadlocks-Träger.
Ein Phantomschmerz geht um. Also genauer ein «Unwohlsein». Es äussert sich in anonymen Rülpsern, und es trifft ausserhalb der «Republik» auf einhellige Ablehnung. Dort wird um Differenzierung gebeten und um den Begriff «kulturelle Aneignung» herumgeeiert.
Aber bei Menschen, die im Vollbesitz ihrer geistigen Kräfte sind, ist die Meinung einhellig: Wer etwas dagegen hat, dass Menschen welcher Hautfarbe, Rasse, Geschlechts, Alters oder Landeszugehörigkeit ihre Haare so tragen wie es ihnen passt, ist ein reaktionärer, rassistischer Idiot.
Ältere Leser erinnern sich noch, dass es eine Zeit gab, als «Langhaarige» in haarige Situationen gerieten. Sie wurden gerne in gewissen Kreisen aufgefordert, sich einen «anständigen» Haarschnitt verpassen zu lassen. Sie lösten damit gelegentlich auch hysterische Reaktionen aus, wurden aufgefordert, sich zu verpissen. Das waren die Zeiten, als man auch schnell Gefahr lief, «Moskau einfach» zugerufen zu bekommen.
Das mit «Moskau einfach» ist etwas aus der Mode gekommen, aber Kritik an Haartrachten feiert ihre Wiederauferstehung. Allerdings, sonst wäre es ja kein schlechter Witz, pflegten vor allem Konservative und Rechte das Tragen langer Haare zu kritisieren. Neuerdings sind es Alternative und Linke, die allergisch auf gewisse Arten, das Haupthaar zu tragen, reagieren.
Sie selbst haben unter ihren Haaren, so noch vorhanden, meistens einen Hohlraum, der mit wenigen Hirnzellen und vielen unverdauten Absichten, möglichst gut und gerecht zu sein, angefüllt ist. Dazu gehört natürlich, dass niemand auf dieser Welt diskriminiert werden darf. Nicht wegen seines Geschlechts, auch nicht wegen seiner Hautfarbe, keinesfalls wegen seiner körperlichen Befindlichkeit. Dick, dünn, gepflegt, ungepflegt, auch beispielsweise gefärbtes, zum Punk-Stachel gegeltes, teilweise rasiertes, zu kunstvollen Knoten verwobenes Haupthaar, auch getöntes, geföntes oder gelocktes, echtes oder falsches, muss toleriert werden.
Aber, so schaut’s aus, es gibt eine Ausnahme. Geboren aus dem Missverständnis, dass Dreadlocks der Ausdruck einer bestimmten Musikrichtung seien und eigentlich nur von Jamaikanern getragen werden dürfen, bürgert sich ein, dass weisse Träger dieser Haartracht diskriminiert werden. Immerhin unabhängig von ihrem Geschlecht oder ihrer Nationalität.
In Bern traf es Schweizer, nun in Zürich einen Österreicher. Die Begründung für solche Diskriminierung von Künstlern ist immer die gleiche. Irgend welche anonyme Verpeilte hätten angeblich ihr «Unwohlsein» geäussert ob dieser angeblichen «kulturellen Aneignung». Es ist denkbar, dass diese anonymen Spassbremsen dabei einen Poncho tragen, sich mit einem japanischen Sonnenschirm beschatten, einen Mojito schlürfen, in eine Kartoffel beissen, den Kaffee aus einer Porzellantasse trinken. Also «kulturelle Aneignungen» im Multipack begehen.
So wie jeder von uns das ständig tut, ohne dass das jemanden stören würde. Ausser, in der verzweifelten Suche nach geliehenem Leiden in der eigenen, ärmlichen und langweiligen Existenz, kommt jemand auf die hanebüchene Idee, sich beim Anblick eines weissen Dreadlocks-Trägers plötzlich «unwohl» zu fühlen.
Der Betroffene (generisches Maskulinum, gell) könnte nun sich übergeben, mit einer angeeigneten Cola den Magentrakt durchspülen oder aber, solange die Teilnahme an einem Konzert noch freiwillig ist, das Weite und frische Luft suchen, um sein Unwohlsein auszukurieren.
Diejenigen, die er mit seinem Unwohlsein belästigt, könnten ihm eine Kotztüte zuhalten, ihres Mitgefühls versichern, ihm den Vogel zeigen oder sich fürsorglich erkundigen, ob es Probleme mit dem Medikamentennachschub gebe.
Stattdessen eiert nun der Veranstalter des nächsten Festivals, an dem Dreadlocks getragen werden könnten (von Musikern. Von weissen Musikern. Von weissen Musikern, die Reggae spielen. Pfuibäh), unsicher rum, wie der «Tages-Anzeiger» berichtet:
««Wir haben uns als Organisationskomitee noch keine abschliessende Meinung zum Thema gebildet», sagt Co-Präsident Kevin Heutschi auf Anfrage, «und wir fühlen uns auch noch nicht in der Lage dazu. Zuerst wollen wir uns informieren.»»
Es gelte aber «im Zweifel für den Künstler», murmelt der SP-Veranstalter des Röntgenplatzfestes, aber er weiss, was er ein paar Fundamentalisten unter seinen Festivalbesuchern schuldig ist: «Eines ist für Heutschi und das OK hingegen klar: «Wir müssen inklusiver und diverser werden.»» Denn bislang stünden vor allem «weisse Menschen, die meisten von ihnen Männer, auf dem Programm. Das müsse sich ändern.»
Wir bei ZACKBUM haben’s einfach. Hier schreibt nur ein alter, weisser Mann. Plus gelegentlich ein paar andere weisse Männer. Wir sehen aber überhaupt nicht ein, wieso wir «inklusiver» oder gar «diverser» werden müssten. Denn wir sind der altmodischen Auffassung, dass es völlig egal ist, wie der Autor eines Textes aussieht, welches Geschlecht, welche Hautfarbe, welche Haarfarbe, wie viele Zähne, Finger oder Zehen er hat. Wenn der Text gut ist, ist das alles egal. Ist er schlecht, rettet mehr Inklusivität oder Diversität auch nichts.
Eine non-binäre Drag-Queen, die entweder asexuell werden will oder sich einer Geschlechtsumwandlung unterziehen, ist als Autor eines guten Textes jederzeit willkommen. Ist der Beitrag scheisse, dann wird er, nicht der Urheber, gnadenlos diskriminiert.
Oder anders formuliert: es gab mal Zeiten, da wurde ein Musiker nach der Qualität seiner Musik bewertet. Aber das waren noch Zeiten, bevor Vollidioten an die Macht kamen.




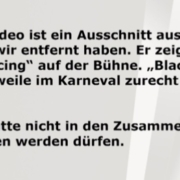

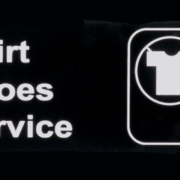




Dein Kommentar
An Diskussion beteiligen?Hinterlasse uns Deinen Kommentar!