Monokultur
In der Landwirtschaft weiss man um die negativen Auswirkungen.
Monokultur im Anbau hat vermeintlich viele Vorteile. Grossflächig, dadurch einfachere Ernte. Die Bauern sind spezialisiert auf ein Produkt, daher kennen sie es aus dem Effeff. Die ganze Infrastruktur, der Maschinenpark, das Saatgut, der Dünger, die Pestizide sind auf ein Produkt ausgerichtet, das vereinfacht alles ungemein.
Durch ständige Forschung und Verbesserung können Ertragssteigerungen realisiert werden. Mit dem gleichen Aufwand mehr Wertschöpfung, ein Zusatznutzen für den Produzenten.
So ging das Lobeslied der Monokultur in der Landwirtschaft. Bis die negativen Auswirkungen immer deutlicher wurden. Grossflächige Gefahr der Ausbreitung von Krankheiten. Schädlingen. Überanspruchung des Bodens durch ausbleibenden Fruchtwechsel. Abhängigkeit der Produzenten von den Herstellern von Düngemitteln, Pestiziden und vor allem auch Samen.
Schliesslich völlige Abhängigkeit von den schwankenden Weltmarktpreisen, die immer die Tendenz haben, bei Knappheit hochzugehen, aber bei Produktionssteigerungen runter, was die Steigerung des Outputs zu einem sehr zweischneidigen Schwert macht, häufig bedeutet, dass mehr Produktivität mit weniger Einkommen bestraft wird. Von den schädlichen Folgen für Mensch und Umwelt ganz zu schweigen.

Monokultur bei Tamedia.
Also geht man inzwischen wieder vermehrt dazu über, auf alte Traditionen wie Dreifelderwirtschaft, Diversität der angebauten Produkte, auf Kleinteiliges umzustellen. Natürlich auch unter Berücksichtigung von Umweltaspekten und der Garantie von stabilen Einkommen der Hersteller.
Während also bei der Landwirtschaft zumindest gegenläufige Bewegungen zur Monokultur erkennbar sind, frönen die Medien dieser Methode immer intensiver. Das ist auch Ausdruck davon, dass so etwas wie Dossierverwaltung zunehmend unbekannt ist.
Monokultur in den Medien
Für jüngere Leser (und Journalisten) sei das kurz erklärt. Früher, als noch alles besser war, gab es genügend Redaktoren bei grossen Tageszeitungen. Die zudem in Konkurrenzkampf zueinander standen und nicht in Newsrooms in Verrichtungsboxen eine klickstarke Einheitssaucse am Laufmeter produzieren mussten.
Es gab also beispielsweise den Spezialisten für Pharma. War sonst nichts los, hatte der ein, zweimal im Jahr seinen Höhepunkt, wenn die grossen Konzerne ihre Jahresberichte veröffentlichten. Die konnte er, gestützt auf jahrelange Erfahrung und ein gutbestücktes Archiv, kompetent analysieren. Die Zwischenzeit vertrieb er sich mit nicht publizierten Untersuchungen oder Interviews mit der Geschäftsleitung. Oder mit Reportagen zum Thema.
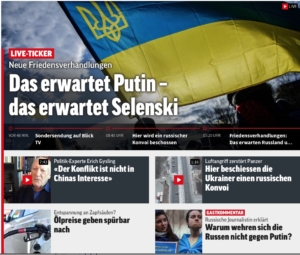
Monokultur beim «Blick».
Ein solches Spezialistentum ist weitgehend passé. Weggespart, als überflüssiges Fleisch vom Knochen des skelettierten Journalismus geschabt. Schon alleine das Lesen (und Verstehen!) einer Bilanz überfordert den durchschnittlichen Journalisten. Aktiva, Passiva, wieso steht das Eigenkapital rechts, was sagt diese Bilanz aus, welche Tricks wurden angewendet, ist sie Ausdruck kreativer Buchhaltung oder realistisches Abbild des Istzustands? Dafür müsste man sattelfest sein.
Da das der gemeine Feld-Wald-Wiesen-Journalist nicht ist, greift er noch so gerne auf die ihm zugehaltene, bereits journalistisch aufgearbeitete Darstellung des Veranstalters des Geschäftsberichts zurück. Titel, Lead, Zwischentitel, strukturierter Aufbau, Illustrationsmaterial, verschiedene Längen, wunderbar. Alternative: Man übernimmt den Ticker der SDA, wozu zahlt man denn da noch das teure Abo.
Kürzere und längere Phasen der Monokultur
Bei diesen Zuständen wird eine neue Form von Monokultur im Journalismus gepflegt. Es gibt die kurze und die längere Monokultur. Corona war lang, der Fall Djokovic war kurz. Die Methode war aber die gleiche. Eine ganze Flut, repetitiv, detailverliebt, bis ins Absurde jeden Pipifax von allen Seiten beleuchtende Berichterstattung. Und gab es gerade beim besten Willen nichts Neues zu berichten, dann wurde gemeint. Kommentiert. Ungefragt Ratschläge erteilt. Forderungen aufgestellt. Jeder Redaktor hatte sich in einen Virologen, Epidemiologen, Fachmann für Visafragen, Spezialisten in der Seuchenbekämpfung verwandelt.
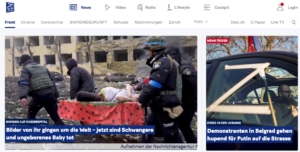
Monokultur bei «20 Minuten».
Inzwischen sind fast alle (mit der bedauerlichen Ausnahme Marc Brupbacher) aus dem Laborkittel geschlüpft und haben sich mit schusssicherer Weste und Stahlhelm bewaffnet. Geradezu rührend wirken die Versuche des deutschen Gesundheitsministers oder von Marcel Salathé in der Schweiz, das Thema irgendwie am Leben zu erhalten. Peinlich.
Denn jetzt ist Krieg. Krieg ist – journalistisch gesehen – viel besser als Seuche. Pandemie, das ist ein unsichtbarer Virus. Blöd. Der Virus ist weder gut noch böse, auch nicht heimtückisch oder hinterlistig. Saublöd. Die ihn bekämpfenden Wissenschaftler lassen sich nur beschränkt als tapfere Helden und Krieger abfeiern. Richtig blöd. Es gibt nicht mal genaue Frontverläufe, alles ist irgendwie in der Schwebe. Todeszahlen, Chaos, Zerstörung, Auflösung der gesellschaftlichen Ordnung: kann man zwar an die Wand malen, aber spätestens nach der zweiten Wiederholung schnarcht das Publikum weg.
Krieg ist in jeder Beziehung für den Journalismus gut
Aber Krieg, das ist gut. Es gibt den Bösewicht und den Helden. Es gibt klare Fronten. Es gibt Tote und Schicksale. Es gibt Waffen und Menschen. Es gibt Unmenschliches und Menschliches. Es gibt Tragödien und Happy Ends. Es gibt Emotionen, Bilder. Jeder Journalist ist nun Militärexperte, beherrscht das Völkerrecht, kann Putin, greift ungeniert auf alle abgelegten Topoi zurück.
Der russische Bär, Russland ist halt doch unzivilisiert, wir haben uns zu recht auch im Kalten Krieg davor gefürchtet. Wer zu verstehen versucht, ist zwar kein Kommunist mehr, aber «Moskau einfach» ist weiterhin angebracht. Jeder kann wieder sein kleinkariertes Schwarzweissraster über die Welt werfen.

Monokultur bei CH Media.
Differenzierung, zu Kritisierendes in der Ukraine, zu Verstehendes in Russland? Niemals. Solche «Versteher» werden ausgegrenzt, abgeklatscht, ganz so wie früher, wo einem ein lobendes Wort über die Errungenschaften des Sozialismus oder ein kritisches Wort über die hässliche Seite des westlichen Imperialismus schwer schaden konnte.
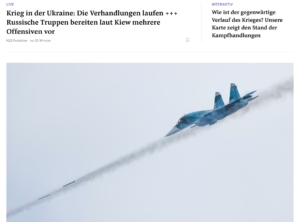
Monokultur bei der NZZ.
Nur war damals die Beschäftigung nicht so obsessiv wie jetzt, gab es in den Medien noch Fachkompetenz, Dossiersicherheit. Heutzutage ist keiner zu klein, Weltenerklärer zu sein. Ist ja auch einfach, in dieser Monokultur der Analysen und Meinungen. Den Vogel schoss hier die NZZaS ab. Sie räumte den gesamten ersten Bund frei, um ausschliesslich ein Monothema zu bewirtschaften.









Es wundert mich, dass noch keiner der Mainstreamjournalisten auf die Idee gekommen ist, dass das Z an russischen Armeefahrzeugen für Zackbum stehen könnte.
Super mal etwas zum Lachen.
Nach den Corona-Experten nun die Ukraine- und Sicherheitsexperten. TAmedia, damit auch SZ, findet fast jeden zweiten Tag noch einen Experten, meistens selbsternannt, der etwas zu Krieg und der Ukraine weiss. Meistens Verlegenheitslösungen weil die Redaktionen Kompetenz abgebaut haben. Dafür «Frögli»-Journalismus, meistens schriftlich geführt, ohne gezieltes, kritisches Nachfragen. Die Zeiten sind halt anspuchsvoll und überfordern die Zeitungsmacher! Dafür viel Blabla- und Peoplejournalismus. Bestes Beispiel, die WW berichtet über die Schwangerschaft von Sünneli Christa Markwalder und Sexberatung!
René Zeyer trifft den Nagel auf den Kopf. Was der Westen der damaligen Presse des sozialistischen Ostblocks vorgeworfen hat, nämlich eine orchestrierte Einheitsmeinung, trifft heute leider auf unsere Presse zu. Nur mit dem wesentlichen Unterschied, dass es hier zu Lande dazu keine Diktatur braucht. Unsere Journalisten passen sich aus schierem Opportunismus und mangels Hintergrundwissen sehr beflissen dem angesagten Mainstream an. So wars bei Trump und Corona und heute bei der Ukraine. Keine Angst auch danach lässt sich gewiss wieder etwas finden. Zum Glück gibts Zackbum, die Weltwoche und das Internet.